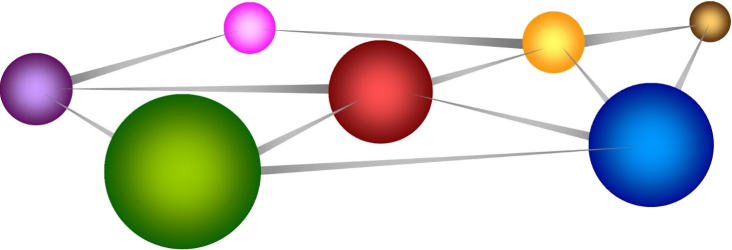Eine Veranstaltung von Netzwerk Inklusion und Stadt Offenbach am 21.03.2017
In angenehmer Atmosphäre trafen sich abends am 21. März 2017 im Stadtcafé Frieda-Rudolph-Haus viele interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema „Älter werden mit Behinderung“. Heidi Weinrich, kommunale Altenplanerin der Stadt Offenbach, lieferte in ihrem Einführungsvortrag aktuelle Daten über die Situation von älteren Menschen mit Behinderung und erklärte die Kernthemen: Wohnraum, Tagesstrukturierung, Bildung (lebenslanges Lernen) und Vernetzung (insbesondere zwischen den Angeboten von Behinderten- und Altenhilfe).
Das anschließende Gespräch wurde von HR-Journalist Andreas Winkel moderiert. Mechthild Rau und Ulrich Gremm vom Suchthilfezentrum Wildhof erklärten, warum eine Behinderung, die durch eine Sucht verursacht wird, eine besondere Herausforderung darstellt. Neben dem Erkennen von Suchtmerkmalen sei es im nächsten Schritt sehr problematisch, zu diesen Menschen einen Zugang zu finden und zu helfen. Thomas Ruff von der Arbeiterwohlfahrt verdeutlichte, dass die Wohnsituation von älteren Menschen mit Behinderungen jeweils sehr individuelle Lösungen brauche. Zusätzlich werde der Bedarf nach behindertengerechten Wohnungen zunehmen.
Es wurde deutlich, dass es notwendig ist, sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede der beiden Personengruppen „Menschen mit Behinderung“ und „ältere Menschen“ zu betrachten. Das Renteneintrittsalter sei für jeden Menschen ein kritisches Ereignis: Gewohnte Lebensabläufe, Tagesstrukturen und soziale Kontakte ändern sich. Bei Senioren liege das Renteneintrittsalter eher bei 65 bis 67 Jahren. Viele Menschen mit Behinderungen gehen aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen bereits mit durchschnittlich 50 Jahren in Rente. Allein wegen des unterschiedlichen Alters können die Interessen und Neigungen also verschieden sein.
40 Prozent der älteren Menschen seien Ein-Personen-Haushalte, der überwiegende Teil davon weiblich. Gerade allein lebende Personen seien auf Angebote im sozialen Umfeld angewiesen, damit sie nicht vereinsamen oder Depressionen entwickeln. Die Pflegekräfte der ambulanten Dienste seien oft der einzige Kontakt. Sie müssen geschult werden, damit sie beurteilen lernen, wie es der betroffenen Person geht. Oder ob sie Unterstützung braucht, um die Wohnung überhaupt zu verlassen. Es gebe oft bereits zahlreiche Angebote im sozialen Umfeld oder im selben Stadtteil. Vieles könne – wie in Offenbach – mit Hilfe eines Quartiersmanagements organisiert werden, so z.B. Treffen zum gemeinsamen Frühstücken oder Spielen, Kochen, Sport, Ausflüge.
Was bedeutet in dem Zusammenhang Inklusion? Inklusion im Alter heiße nicht, dass alle älteren Menschen (mit und ohne Behinderungen) nun aufgefordert sind oder dazu überredet werden sollen, sich an den gemeinschaftlichen Treffen im Quartier zu beteiligen. Inklusion bedeute vielmehr eine selbstbestimmte Teilhabe und die Berücksichtigung individueller Interessen. Niemand dürfe ausgeschlossen werden. Für die Stadt Offenbach heiße dies dafür zu sorgen, vorhandene Barrieren zu beseitigen, Orte erreichbar und zugänglich zu machen. Es müssen zudem ausreichend Angebote älteren Menschen mit Behinderungen geschaffen werden.
Als einen positiven Schritt auf dem weiteren Weg zur Inklusion wurde vom Publikum das Beispiel Mehrgenerationenhaus ins Spiel gebracht. In einer Zeit, in der die Generationen sich nicht mehr gegenseitig in der Großfamilie versorgen, liefere diese Wohnform eine alternative Lösung. Auf der Basis von Vereinbarungen entstünden verlässliche Nachbarschaften von Menschen jeden Alters, mit oder ohne Behinderung. Es gebe in einem Mehrgenerationenhaus wie in der Weikertsblochstraße auch einen Gemeinschaftsraum für Nachbarschaftstreffen. Dieses Konzept sei mindestens so attraktiv wie Modell des Zusammenlebens in einem großen Wohnblock an der westlichen Stadtgrenze Offenbachs. So gebe es in einem Mehrgenerationenhaus wie in der Weikertsblochstraße einen Gemeinschaftsraum, der eine sehr gute räumliche Voraussetzung für Nachbarschaftstreffen darstelle. Eine gute Ergänzung zu punktuellen Angeboten gemeinschaftlichen Wohnen seien darüber hinaus Angebote, die sich auf eine stärkere nachbarschaftliche Verknüpfung in den einzelnen Stadtteilen stützen. An dieser Stelle käme wieder ein Quartiersmanagement ins Spiel, um diese Verknüpfung zu organisieren und zu unterstützen.